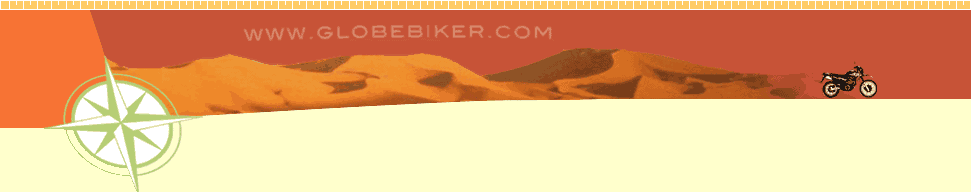
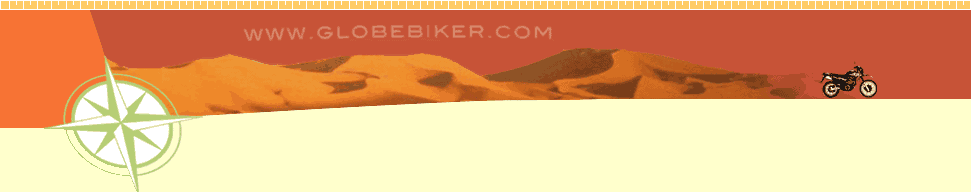
RALLYEFIEBER
Ein Überblick

V O R G E S C H I C H T E
„Wohin geht die nächste Reise?“ war eine der häufigsten Fragen nach meinem 5-monatigen
Motorradtrip von Wien nach Kapstadt. „Ins Salzkammergut!“ lenkte ich immer ausreichend davon ab, dass
Motorradfernreisen kaum mit einem normalen Berufsleben vereinbar sind. Einerseits hätte mich eine
Wiederholung, eine weitere Fernreise momentan nicht gereizt, andererseits hatte ich noch keine
Ahnung, welche Herausforderung mich hinterm Ofen hervorlocken könnte.
Unter Garantie in ihren Bann gezogen haben mich jedes Jahr die Aufnahmen der Dakarhelden, die
auf ihren unbezahlbaren Rallye-Ungetümen durch die Endlosigkeit Richtung Horizont jagen. Damit
war die Sache klar – ich will auch!
Mensch- und materialmordende Monsteretappen, logistischer Megaaufwand und Teilnahmekosten in
Höhe eines vollausgestatteten Mittelklassewagens – genauso regelmäßig kühlten existenzberechtigte
Gegenargumente das heiße Begehren, selber teilzunehmen.
Vor einem guten Jahr erfahre ich von der Tuareg-Rallye, auf der sich nicht nur Dakar-Profis matchen,
sondern auch Einsteiger in einer eigenen Amateurklasse starten können. Das ist die Chance, den
Traum Wüstenrallye zu verwirklichen!
Nach der Afrikadurchquerung wagte ich mit Fug und Recht zu behaupten, dass ich Motorradfahren
kann. Ein bisschen Geländemotorradfahren vorher wär halt nicht schlecht, also buche ich ein
Hardenduro-Training samt Leihmotorrad. Nicht, dass an der XT je etwas auszusetzen gewesen wäre,
aber fürs grobe Gelände darf’s ein reinrassiges Sportgerät sein, wieder eine Yamaha. Nur diesmal
eine WR450F mit 32cm Federweg und 60 kg weniger auf der Waage aber dafür 10 PS mehr im Motor
– die reinste Lenkwaffe, und das in meinen kompetenten Händen! Zur Sicherheit telefoniere ich mit
dem Veranstalter. "Bin ich eh nicht in der Lulu–Fraktion, bei den Anfängern?!"
Der Hardenduro Trainingstag war der reinste Erfolg – für die Yamaha! Regelmäßig katapultierte mich
die kleine Dreckschleuder in die Botanik und im besten Fall fuhr sie mit mir statt umgekehrt.
Gedemütigt und mit 2 cm längeren Armen bleibt mir vorerst nur, die Strategie gründlich zu überdenken
und erst mal richtig Offroadfahren zu lernen.
Im Mai bekommen die meisten Angestellten ihr Urlaubsgeld in Form eines zusätzlichen Gehaltes. In
diesem Mai 2007 ergab es sich unerwartet, dass mein Arbeitgeber auch eine Erfolgsprämie
ausbezahlte.
Die Sterne standen gut, denn gleichzeitig hat Yamaha die 07er Version ihrer erfolgreichen WR - Serie
mit dem neuen Alurahmen und überarbeitetem Motor auf den Markt gebracht. Der neue Rahmen
brachte keine, und der neue Motor wenig signifikante Änderungen, aber die 06er Modelle waren mit
einem Schlag nicht mehr gefragt. Panikartig warfen die Händler die funkelnagelneuen Vorjahres-WRs
um bis zu 30% ermäßigt unters offroadlüsterne Endurovolk. Eine davon, mit dem schonenderen 250er
Motor, landete in meiner Garage.
Wann immer es Zeit und Wetter zuließen, war ich mit der Kleinen im Gelände unterwegs. Viele
Wochenenden mit Freunden in abgesperrten Enduroparks oder organisierten Trainings. Die
Kratzspuren auf den Plastics nahmen genau so zu wie die Anzahl meiner blauen Flecken. Auch zu ein
paar Offroad-Rennen habe ich mich hinreißen lassen. Eigentlich hasse ich Motorradrennen, finde es
einfach nur krank, unter Zeitdruck im dichten Gedränge Motorrad zu fahren. Eine Rallye ist natürlich
auch ein Rennen, nur komplexer, interessanter.
Entsprechend mulmig fühle ich mich am Massenstart zu meinem ersten Zweistundenrennen. Vor der
Horde adrenalingeiler Vollgasathleten zählt der Startflaggeschwenker von zehn herunter. Da brüllt ein
Fahrer zu seinem Kumpel „Hears Koarl, wannst gwinnst geh i mit Dia in Swingaclub!“ „3, 2, 1, Start!“
RRROOOOOAAAAAAAAARRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!
Monate vor der Rallye sichere ich mir einen Startplatz und beginne, die wesentlichen Änderungen wie
größeren Tank, Roadbookhalter und Tripmaster an meiner Enduro vorzunehmen. Neue Reifen
müssen auch her.
Michelin Desert heißt der dakarerprobte Flurschädling. Die Karkasse ist so steif, dass man im Notfall
sogar ohne Luft fahren kann! Ihn auf die Felge aufzuziehen erfordert Knowhow, gutes Werkzeug und
Kraft. Mehr als eine Montiermaschine hat schon dran glauben müssen, mehr als ein
Geländemotorradfahrer hat deshalb schon Hausverbot beim Reifenhändler seines Misstrauens.
Die Verdichtung der Zeit war nur eines der mysteriösen Phänomene während der letzten
Vorbereitungswochen. Wie wäre es sonst zu erklären, dass die letzte Schraube 15(!) Minuten vor
Abreise angezogen wurde. Laut Projektplan hätte das satte 2 Wochen vorher sein sollen!
Unerklärlich auch die kosmischen Strahlen, welche die Endurohose im Kasten schrumpfen ließen und
die Schwungmassen, die im Motor eigentlich einen ruhigen Lauf ermöglichen sollen, waren auf
meinen Hüften!
DIE RALLYE
Das Wichtigste bei einer Rallye sind Blumen für die Freundin. Mit viel Liebe, Toleranz und Wohlwollen
hat sie meine reduzierte Ansprechbarkeit der letzten Wochen erduldet.
Verspätet erscheine ich bei meinem Mitstreiter Klaus. Er ist, wie nicht anders zu erwarten, perfekt
organisiert. Wir laden seine LC4 auf den Hänger, Rallyebox und Equipment verschwinden in den
unendlichen Weiten des Laderaums meines Dacia Logan.
Erster Zwischenstop ist in Bled, Slowenien, wo wir Niko treffen. Kaum haben wir uns gesetzt, steht ein
warmes Abendessen und die ersten Biere vor uns. Niko ist ein aufgeweckter Gesprächspartner, der
sich ausgezeichnet darauf versteht, die Mentalkraft seiner Renngegner am Vorabend mit Alkohol zu
unterminieren. Im Gegensatz zu uns hat Niko schon Rallyeerfahrung. An der Wand hängt ein Foto von
einem kopfüber im Wüstensand steckenden Motorradfahrer, dessen verbogener Körper gerade vom
nachfliegenden Motorrad erschlagen wird. „Yes, that’s me!“. Es gibt Momente, da weiß man nicht wie
man reagieren soll. Wie lange war er wohl im Koma? „Always remember, when there are many
photographers on one spot – drive carefully!“ Er scheint weder Gesundheit noch Humor verloren zu
haben. Noch einen guten Satz schenkt er uns: „Half of the way to the finish line is to reach the start!“
Damit spricht er mir aus dem Herzen. Die zweite Hälfte verrät er uns nicht, er schenkt uns ein, bis wir
nicht mehr konkurrenzfähig sind.

Die Füsse verlassen die Fussrasten erst, wenn der Kopf am Boden aufgeschlagen hat!
Rund 28 Fahrstunden sind noch nach Almería, Südspanien. Ohne Hänger wären es fünf Stunden
weniger. Da wir uns einig sind, lieber Motorrad als Auto zu fahren, bringen wir diesen Part non-stop
hinter uns. Fahrerwechsel alle 2 Stunden, rechtzeitig bevor einer müde wird oder der andere sich zu
Tode langweilt.

Über Udine, Venedig, Genua geht die Fahrt durchs motorsport-begeisterte Italien. Mit den geilen
Rallyemaschinen am Hänger erregen wir Aufmerksamkeit, LKWs hupen, die Fahrer winken. Wir sind
genauso begeistert von uns und winken zurück! Bis wir entdecken, dass sich das meterlange Ende
eines Spanngurtes gelöst hat. Das nachgeschliffene Teil schneiden wir ab, es ist völlig zerfranst, sieht
aus wie ein grüner Ponytail mit TÜV-Gutachten.
In Italien darf man mit Hänger nur 80km/h fahren. Wer mehr als 30km/h zu schnell ist, dem darf die
Polizei das Fahrzeug beschlagnahmen. Wir justieren mit(?) unserem Gewissen auf max. 100km/h.
Das ist eine gute Geschwindigkeit. Entspanntes Tempo bei einem gnädigen Verbrauch von 7L in der
Ebene. Gnadenlos dafür die Maut: € 70,-- kostet die Durchreise Italiens, fast so viel wie eine
Jahresvignette für Österreich.
Im warmen Licht des späten Nachmittags erreichen wir die Cote d‘Azur, fahren an Monaco und Nizza
vorbei und beschließen bei Einbruch der Nacht, einfach durchzufahren. Extra ein Hotel zu suchen, wo
wir Hänger mit Bikes sicher abstellen können, erscheint uns zu umständlich. Zwischen Mitternacht und
6 Uhr machen wird stündlich Fahrerwechsel. Das hat sich bewährt.
Viel hat man ja nicht zu tun. Man hält die Fuhre auf Kurs, freut sich über die leeren Straßen und wirft
ab und zu ein Blick auf die Tankuhr oder das Navi.
Überhaupt, das Navi! Ich arroganter Kartenleser habe diese Computerspielchen ignoriert, mich
bestenfalls über die Leute amüsiert, die beim Heimfahren am Sonntagabend auf der Südautobahn
eine Orientierungshilfe brauchen!
Für eine Fahrt nach Wels hab ich eines zum Testen bekommen. Blöd nur, dass es Wels nicht gekannt
hat. Wohl ein Wels-West, dort gab es aber nicht die gewünschte Strasse! Zufällig kannte ich die
Postleitzahl von Wels, nur mit der hat sich das Gerät dann zurechtgefunden! Abgesehen von dieser
„Kleinigkeit“ schätze ich heute dieses kompetente Kastl, dessen bunt leuchtendes Display die
Kommandozentrale des PKWs krönt.
Erfreulich die Anzeige der voraussichtlichen Ankunftszeit, Kilometer bis zur nächsten Abzweigung,
rechtzeitige Info wann und wo man sich einordnen muss – herrlich entspannend, besonders wenn der
Copilot den Schlaf der Gerechten schläft. Das Ding weiß auch, wann die Sonne untergeht und
schaltet auf gedämpfte Farben. Noch während wir uns darüber unterhalten, dass in Berlin angeblich
einmal ein Auto in einen Fluss gefahren ist, weil das Navi eine Brücke „kannte“, überrascht uns die
Anweisung unseres Navis, mitten in der Poebene bei San Exkremento die Autostrada zu verlassen,
Maut zu bezahlen, um anschließend wieder auf die Autobahn in gleicher Richtung weiterzufahren.
Klaus meint, dass komme äußerst selten vor und hängt mit Unterbrechungen in der Kartensoftware
zusammen. Ich meine gar nichts.
Durchs Lichtermeer Barcelonas führt unser Nachtflug. Nach Stunden zeigen die ersten
Sonnenstrahlen trockenes, felsiges Land. Die angeschriebenen Städte fangen häufig mit der
arabischen Silbe „Al“ wie Alicante, Alberra, Almeria an. Erinnerung an die Jahrhunderte maurischer
Besetzung der Iberischen Halbinsel.
An der Südküste entlässt uns das karge Inland ins Paradies. Wir sind in Mojacar, dem inoffiziellen
Treffpunkt vor der Rallye. Hinter uns liegen 4 Monate Winter, vor uns kilometerlange Sandstrände,
Palmen, blauer Himmel, weiß getünchte Hotels und Appartmenthäuser reihen sich aneinander, eine
Bar, ein Shop neben dem anderen und alle warten bei 25°C erst auf die Hauptsaison.
SMS von zu Hause: „Haben Schneechaos!“ Der blühende Tourismus hat in den letzten Jahren zu
Spekulationen geführt. Immobilien waren eine sichere Sache. Leider hat man übersehen, dass der
reale Bedarf irgendwann gesättigt war und Millionen (!) Appartements und gleich mehrere Dutzend
Golfplätze zu viel gebaut. Die sind heute „Se vente“, wie häufig auf Schildern zu sehen ist. Unter
anderem zu diesem Thema sei der Film „Let’s make money“ nachdrücklich empfohlen.
Es ist Samstag, wir sind also einen Zeitreservetag zu früh im Süden. Doch zu früh die Vorfreude auf
Strand und Faulenzen, zu viel ist noch zu erledigen. Treffpunkt der Rallye ist morgen Mittag im 80km
südlichen Almería, dann Überfahrt und Start Montagvormittag in Nador, Marokko.
Konkret werden wir uns bis Montagabend von unserem Gepäck trennen müssen. Das wird von der
Rallye-Organisation (Eingeweihte dürfen sie ORGA nennen) im Rahmen des gebuchten Service-
Paketes von einem Nachtquartier zum nächsten transportiert. Untertags hat man nur sein Motorrad
und das, was man am Körper trägt. Und genau um das geht es!
Wie schön wäre es, wenn ich schon genau wüsste, wo die Notausrüstung (Signalraketen, Kompass,
Erste Hilfe, Wasser) sowie Ersatzteile und Werkzeug am sinnvollsten untergebracht werden. Klar
wuchern theoretische Vorstellungen, was wie am besten verstaut wird. Das meiste passt dann auch in
der Praxis, dennoch bleiben so viele zeitraubende Kleinigkeiten, an denen getüftelt werden muss. Die
komplette Rallyemontur trage ich zum ersten Mal im Hotelzimmer von Mojacar und stelle fest, dass
der volle Trinkrucksack auf der viel zu schweren Werkzeughüfttasche aufliegt und das so nicht
angenehm zu tragen ist.
Von der Pflicht zur Kür: Wir haben uns eine Profihelmkamera, eine VIO P.O.V. 1.5, gekauft und noch
keine Ahnung, wie sie funktioniert. Zum Glück ist das Ding nicht für EDV-Fuzzis sondern für Outdoor-
Cracks konzipiert. Kabel anschließen, Objektiv auf den Helm kletten und auf der kabellosen
Fernbedienung am Lenker „Record“ drücken. Fertig.

Die Sonne ist längst untergegangen bis alles fertig war. Auch für Auto plus Restgepäck und Hänger ist
ein sicherer Platz gefunden, die ersten Kontakte zu anderen Teilnehmern sind geknüpft, die Rallye-
Kisten am Servicefahrzeug, die Zahnbürste im Trinkrucksack, die Sonnencreme vergessen – es kann
losgehen!
Als Rallye-Einsteiger, als „Ersttäter“, haben wir nur eine ungefähre Ahnung, was uns bevorsteht. Es
ist, Wüste hin oder her, ein Sprung ins kalte Wasser.
Kleine, wendige Sportenduros sind lustig zu fahren, solange man offroad herumspielt. Bei einer
WR250F mit ihrem brettelharten, schmalen Sattel – manche nennen ihn Werkbank, über 300mm
Federweg und vorgeschriebenen Ölwechselintervallen von 1000km kann man überlegen, ob nicht die
Bezeichnung „Sportgerät“ statt „Fahrzeug“ besser passt. Es drückt am Hintern und Gewissen, auf so
einem Ding die 100 Autobahnkilometer vom „inoffiziellen“ Rallyetreffpunkt Mojacar zum Hafen nach
Almería abzusitzen. Während der Fahrt sind am Pannenstreifen zwei größere Rallyemaschinen
auszumachen. „Könnt Ihr der Orga ausrichten, dass Nummer 70 und 72 später kommen, die
Benzinpumpe auf der LC4 meines Kumpels ist ausgefallen, wir überbrücken sie gerade“. Machen wir
gerne. Zum Glück hat mein Motorrad keine Benzinpumpe, das wäre Wasser auf den Mühlen meiner
Pannenparanoia.
Rallyemotorräder entsprechen selten dem Kraftfahrzeuggesetz. Zwar müssen die Fahrzeuge
ordnungsgemäß angemeldet sein, aber in den allermeisten Fällen erlischt die Betriebserlaubnis mit
der Verwendung von modifizierten Auspuffanlagen, nicht eingetragenen Fahrwerkskomponenten, kein
Mensch hat Blinker oder Rückspiegel, die Beleuchtungsanlage ist reduziert – die Liste der
Kapitalverbrechen ist endlos.
Zwei BMWs der spanischen Motorradpolizei überholen mit blinkenden Blaulichtern. Die sind ganz
sicher straßenzulässig. Wir bewegen unsere Kisten im Grenzbereich, genauer gesagt im
Toleranzbereich der Exekutive. Klaus auf seiner seriennahen Adventure hat nichts zu befürchten.
Meiner WR fehlen Blinker. Für die Anreise und die bevorstehenden Verbindungsetappen habe ich aus
einer Laune die Rückspiegel montiert. Das verkleinerte „Sport“-Kennzeichen ist eine laminierte,
farbkopierte Urkundenfälschung. Für die ernte ich nur einen schiefen Blick und Kontrolle von
Fahrgestellnummer und Zulassungsschein.
„Muchachos, wir wollen ja nur die paar Kilometer zum Hafen, weil weiter geht’s eh in Afrika!“ Dieser
Umstand, unser diszipliniertes Verhalten und eine Portion Glück waren der Toleranzbereitschaft der
spanischen Rennleitung (Autobahnpolizei) zuträglich. Nicht beeindruckt hat meine Schleimattacke „He, Senior Inspektor,
Gewinner der heurigen Dakar-Rallye war doch der berühmte Marc Coma, ein SPANIER!“. Lapidar der
amtliche Conter: „This is not a rallye“.
Voll erwischt hat es Niko. Kein Licht, keine Spiegel und gar kein Kennzeichen – es sind nur die
augenscheinlichsten Abweichungen von jeder europäischen Kraftfahrzeugsgesetz- und
Straßenverkehrsordnung. Niko trägt die € 60,-- Strafe mit Fassung. Genau genommen Glück gehabt.
Wir wissen, die Beamten hätten ganz einfach auch eine weitere Inbetriebnahme des Fahrzeuges
untersagen können.
Am Rallyetreffpunkt, dem großen Platz des Hafengeländes, stehen in Reih und Glied die monströsen
Service-Trucks und Motorräder, die jedes Rallyeherz höher schlagen lassen! Hier schiffen wir uns zur
Überfahrt nach Nador, Marokko, ein, wo am nächsten Morgen die Rallye starten wird. Zeit genug, um
die Roadbooks mit Leuchtstift zu markieren und zusammenzukleben. In einem ersten Briefing gibt
Cheforganisator und Tuareg-Mastermind Rainer Authenrieth die Streckeninfos für den nächsten Tag
bekannt und erläutert organisatorische Belange sowie Sicherheitsvorschriften.
Die 24 Stunden von Treffpunkt bis Start sind auch von Warten und Anstellen geprägt. Den kompletten
Rallyetross mit rund 200 Motorrädern, dutzenden Autos, Service-Trucks und Rettungsfahrzeugen
samt Fahrern, Begleitpersonal und Organisationsteam von Europa ins einige hundert Kilometer
entfernte Afrika zu bringen und das zu administrieren, ist ein Bravourstück. Das darf man nicht
vergessen, während man sich anstellt bei der administrativen und technischen Abnahme, Kontrolle
der Notausrüstung, bei der Station, wo die GPS-Punkte aufs Navi gespielt werden, der
Auswanderungsbehörde, beim Einschiffen, der Kabinenschlüsselausgabe, dem Frühstück, bei der
marokkanischen Einwanderungsbehörde, beim Ausschiffen, beim Zoll für die Fahrzeugeinreise, beim
Geld wechseln und schließlich am Start, der dann verhältnismäßig unspektakulär abläuft.

Keine große Rampe mit Blitzlichtgewitter und tausenden jubelnden Fans, stattdessen kann jeder
losfahren, wie es ihm passt. Hauptsache, man hat seine Rennkarte abgeholt, auf der werden Abfahrtsund
Ankunftszeiten eingetragen, die dann Grundlage für die Wertung sind.
Los geht’s mit einer Navigationsetappe, die nur innerhalb einer Sollzeit gefahren werden muss.
Roadbooklesen kenne ich nur aus der Theorie. Denkbar ungünstig, das fahrend in der Hektik eines
unberechenbaren Stadtverkehrs in Afrika zu üben. Bleibt nur, was ich tunlichst vermeiden wollte – ich
schließe mich der soeben von der Leine gelassenen Motorradmeute an.
Noch im Ortsgebiet knallt ein Teilnehmer in einen alten Kombi, der aus einer Seitengasse eingebogen
war. Der arme Kerl wird am Straßenrand erstversorgt. Die Bremsspuren seiner funkelnagelneuen
BMW sind über drei Fahrzeuglängen lang. Es könnte einem schlecht werden, schon nach nicht einmal
zwei Kilometer ist seine Rallye zu Ende.

Im Roadbook stehen Hinweise wie „letzte Tankstelle für die nächsten 160km“. Die markiert man extra
fett. Oder: Richtungspfeil bei Streckenkilometer 27,8 zeigt nach links, wo man auf eine „Gravel Road“
abbiegen muss. Wer solche Hinweise versäumt, hat in aller Regel ein Problem. Als die Stadt vorbei ist
und wir uns auf besagter Schotterstrecke tummeln, komme auch ich in Fahrt und das Roadbooklesen
wird zum Spaß und schnell zur Routine. Eine traumhafte Route führt auf unbefestigten Wegen übers
Hügelland Nordmarokkos. Die Profis müssen einem engen „Eselspfad“ auf einen steilen Berg
nehmen. Wem es zu schwer war, der darf am ersten Tag noch zu den Amateuren wechseln.
Tag 1 hat auch die erste Sonderprüfung parat. Das heißt, man fährt eine Teilstrecke auf Zeit. Es gibt
kaum einen schlechteren Zeitpunkt, um sich zu verfahren, was mir leider prächtig gelingt. Wer mit der
klugen Taktik unterwegs ist, sich nicht unnötig zu verausgaben, fährt wie gewohnt, nur werden
Pinkelpausen ausgelassen. Ich tappe in eine Falle, denn die Navigation hat erstmals kniffelige Stellen,
die deutlich höhere Genauigkeit erfordern. Erst nach etlichen Kilometern und einer gefühlten Ewigkeit
finde ich mit Hilfe der GPS-Trackaufzeichnung wieder auf die Route.
Wer dem Navigationsenthusiasmus einen noch festeren Dämpfer verpassen will, verfährt sich im
Bereich einer versteckten Durchgangskontrolle, denn das gibt vier Stunden Zeitstrafe! Auch diesen
Anfängerfehler bekomme ich heute zu verdauen.
Auch Klaus bekommt sein Fett ab. Seine LC4 und er konnten sich nicht auf dieselbe Richtung einigen.
Beim ersten Sturz beleidigt er sein Handgelenk, beim nächsten die Befestigung für den
Roadbookhalter.
Die Hand ist schön geschwollen, aber ok, die Halterung wird abends in Missour mit sanfter Gewalt und
neuen Schrauben wieder in Form gebracht. Abends ist überhaupt ein guter, genau genommen der
einzige Zeitpunkt, um sich wieder zu organisieren. 20 Uhr gibt’s Briefing mit Infos für den nächsten
Renntag. 21 Uhr Abendessen. Vorher und danach bleibt ein wenig Zeit für Pflege von Mensch und
Maschine, mit Glück für ein kleines Bier.

Wach macht, was Krach macht - früh morgens reißt uns deutscher Hardrock aus dem Schlaf. Zwei
große Lautsprecherboxen lassen mit Rammsteins „Sonne“ die Erde beben, die Gockelhähne der Stadt
sind völlig aus dem Häuschen.
Stell Dir vor, Du erwachst so aus einem komatösen Tiefschlaf, stellst fest, dass Du mitten in Afrika auf
einer Rallye bist, solltest eher zügig Frühstücken, Dein Gelumpe packen, in Stiefel und Gewand
hüpfen und ohne Umschweife zum Prestart navigieren, um den Tag mit einer Sonderprüfung zu
beginnen. Das ist die Intensität, mit der fast jeder Tag beginnt.

Die Strecke des zweiten Tages ist genial, teilweise verläuft sie entlang der ehemaligen Dakar,
endlose Ebenen, in denen um diese Jahreszeit Blumenmeere blühen, durch schroffe Canyons,
Flussoasen, die ersten Sandfelder sorgen für Stürze, Felspisten über hohe Pässe in versteckte Täler
für prächtige Aussicht. Nach 9 Stunden bin ich körperlich und mental ausgelaugt, überreizt von
Sinneseindrücken und randvoll mit Adrenalin. Nach 380 km der letzte Secret Checkpoint am Ostrand
eines riesigen Dünengebietes, dem Erg Chebbi. Aktuelle Roadbookanweisung: 1km 270° geradeaus
über „small dunes“ nach Westen fahren. Mist, gerade jetzt will ich nicht Sandfahren lernen, ich bin
noch nie mit dem Motorrad auf Dünen gefahren! Keine Ahnung wie, aber die kleinen Dünen waren
halb so schlimm.
Die nächste Anweisung im Roadbook lässt erst Freude aufkommen: direkt zum Hotel! 6km 270°
geradeaus nach Westen – über „big dunes“! Mir wird übel, die sind ja wirklich groß, und weit und breit
kein Mensch. Wie waren nochmal die Notfallanweisungen der Orga zum Abfeuern der Signalraketen?
Die quälende Frage, ob meine bewährte 250er ausreichend Kraft fürs Dünenfahren hat, zermürbt mich
schon lange. Hinter den großen Dünen geht der orange Sonnenfeuerball unter, und es warten
Abendessen und Dusche.
Ich senke den Reifendruck auf 0,5bar ab, das erhöht laut Sandfahr-Theorie die Auflagefläche des
Reifens. Ebenso soll man das Gewicht nach hinten verlagern, weit vorausblicken und schnell eine
gute Spur suchen, den Rest mit Vollgas erledigen. Die Praxis wird zum Triumph. Mit dem leichten
Motorrad, den extremen Stollenreifen und etwas Schwung klappt das Dünensurfen nach wenigen
Minuten. Es ist ein großartiger Spaß, macht so viel Freude, ich bin erleichtert und überglücklich!
Ich will nicht runter von dem Trip, ich kann nicht! Nachts im Schlafsack schließe ich die Augen und
sehe nur Bilder von der Fahrt, Steine, Büsche und Sandfelder an mir vorüber ziehen.

„Königsetappe für die Amateure“ nennt Cheforganisator Rainer den dritten Tag. Teilweise müssen
immense Strecken in weichpulverigen Sanddünen bewältigt werden, die Navigation ist anspruchsvoll,
wo kein Weg auszumachen ist, wird per GPS „auf Richtung“ gefahren. Am Abend zuvor habe ich den
Anfängerfehler begangen, Arbeiten wie Luftfilterwechsel, Roadbook einkleben und kleine Reparaturen
auf den nächsten Morgen zu verschieben. In der Früh war dann in der Hektik nicht mal Zeit für einen
Klogang, entsprechend entnervt erscheine ich zur Sonderprüfung. Schon nach den ersten 200 Metern
„nehme ich eine Bodenprobe“ im weichsandigen Erg. Mir platzt der Kragen. Die ausbrechende Wut
über die Unpässlichkeiten des Morgens und den Sturz kommt gelegen, denn Lethargie und
Unentschlossenheiten bringen im Sand nicht weiter. So reiße ich das Gas auf, klemme die Maschine
zwischen die Knie und plötzlich gleite ich wie ein Experte über die Dünen und übersehe fast einen
Secret Check Point – zum Glück war er mit einer Fahne markiert.
Dieser Flow macht süchtig, man verliert sich darin und schließlich verliere ich die Orientierung. Vor mir
liegen nicht „big dunes“ sondern „the extreme dune“. Unglaublich, die ist sicher 250 Meter hoch. Noch
bevor zu viel Respekt aufkommt, lasse ich den kleinen Motor brüllen und suche „meine“ Spur auf die
vorgelagerten Dünen, finde Passagen, die mich höher bringen, nehme ein letztes mal Schwung, gebe
Vollgas, bis der Motor in den Begrenzer dreht und triumphiere schließlich auf einem der höchsten
Dünenkämme des Erg Chebbi.
Beim Blick in den Abgrund rutscht mir das Herz in die Hose. Auf der anderen Seite ist die Düne viel
steiler! Ich gebe den ersten Gang rein, stelle mich auf die Fußrasten, verlagere das Gewicht so weit
wie möglich nach hinten und komme wundersam kontrolliert unten an.

Mittags am Checkpoint 3 packe ich einen Thunfischsalat, ein Glas Krautsalat und als Nachtisch einen
Müsliriegel aus dem Rucksack. Mein Blick fällt auf eine geparkte Yamaha XT600. Die XTs sind eine
Legende, aber die Zeiten, in denen sie auf Rallyes noch Blumentöpfe gewonnen haben, sind schon
fast 30 Jahre vorbei. Dennoch eignen sie sich nach wie vor hervorragend für ganz große
Motorradabenteuer.
2005/2006 habe ich eine XT quer durch Afrika getrieben, da schlägt das Herz natürlich höher, wenn
man eine sieht, die noch „artgerecht“ gehalten wird.
Diese hier ist veredelt mit exklusiven Spezialteilen, pipifeines Federbein, Stahlflex-Bremsleitung,
Rennauspuff – das ganze Spielzeug halt, für das wir unser Taschengeld ausgeben. Berühmt wurde
diese Maschine durch die Tuareg-Berichte Ihres Besitzers Pitter. Mit ihm hatte ich schon vor Jahren
Kontakt und plötzlich stehen wir uns mitten in der Wüste gegenüber!
Viel Zeit bleibt wieder einmal nicht, da aus Sicherheitsgründen jeder, je nach individueller Startzeit, zu
festgelegten Zeitpunkten die Durchgangskontrollen passiert haben muss. Wer zu spät dran ist,
bekommt Strafzeit und muss schlimmstenfalls mit dem Konvoi auf der Assistenzroute ins Camp.
16:17 Uhr ist meine Deadline. Punkt 16:17 am letzten Checkpoint drücke ich der feschen Dame von
der Orga – im Zivilberuf ist sie Unfallchirurgin - die Rennkarte in die Hand. Keine Zeitstrafen, perfekt
gefahren. Lächelnd trägt sie die Ankunftszeit ein, erklärt den Weg ins Lager und wünscht einen
schönen Abend, speziell viel Spaß beim Duschen.
Im Camp angekommen treffe ich Klaus und Alex. Beide frisch gewaschen und gebügelt. Beide haben
im Sand mit ihren etwas übergewichtigen LC4 bzw. F650 Motorrädern nicht ihr Element gefunden und
einen Tag am Pool als sinnvolle Alternative gefunden.
Trotz der triumphalen Fahrt, des Adrenalin- und Endorphinüberschusses biete ich optisch
offensichtlich ein wenig ansprechendes Bild, verdreckt von oben bis unten, sandige Nase, verschwitzt,
zerzauste Haare und erschöpft. Oder wie es Alex ausdrückt „etwas derangiert, der junge Herr!“.

Fest entschlossen, heute keinen Handgriff auf morgen zu verschieben, finde ich mich in einer Ecke
des Hotelgeländes, wo die Fahrer ohne Serviceteam an ihren Bikes basteln. Es ist ein
zweischneidiges Schwert, sich an diesem Hotspot zum Schrauben niederzulassen. Man lernt die
nettesten Leute kennen, der Schmäh rennt, hilft sich mit Ersatzteilen, kann Tipps einholen oder wird
auch mal ohne Bedarf zugetextet, bekommt ein Bier in die Hand gedrückt, verliert sich in Geselligkeit
wie untertags in der Wüste. Gegen halb acht bricht die Nacht herein und das halb zerlegte Moped
steht immer noch am Platz. Meine Stirnlampe ist leider ein Glühwürmchen mit Gummiband, das mach
ich nächstes Jahr besser! Zum Glück hat Klaus eine Art Flak-Scheinwerfer am Kopf und hilft, den Rest
fertig zu machen, denn in 30 Minuten ist Briefing und dann Abendessen.
Der vierte Renntag ist die offizielle Königsetappe und spielt sich nur im Sand ab. Kreuz und quer
durch den Erg Chebbi führt ein großräumig angelegter Rundkurs. Dünen bis zum Abwinken. Zwei
Runden für die Amateure, vier für die Profis. Alles auf Zeit.
Gleich nach dem Start leiste ich mir, noch unaufgewärmt, den ersten Fahrfehler, rase schräg über
einen Dünenkamm und detoniere würdelos im Steilhang. Nachdem sich die Sternchen verzogen
haben und der Sand ausgespuckt ist: Stapfen zur Abflugrampe und markieren der Unfallstelle mit
Helm, genau so wie es bei jedem Briefing angeordnet wird. Safety first – bei jeder DK die Frage, ob
man genug getrunken hat, vor jedem Start Kontrolle der Sicherheitsausrüstung. Wer was vergisst, darf
– je nach Relevanz – nicht starten oder kassiert Strafzeit. So wie Niko, der heute schnellster Amateur
ist, aber wegen vergessenem Pass 30 Minuten Penalty bekommt und nicht erster wird.
Die Mittagshitze lässt den Sand weich und weniger tragfähig werden. 25 Minuten hab ich vertrödelt –
man ist ja im Urlaub – und statt Runde zwei mache ich es mir am Pool bequem. Es bleibt auch Zeit für
einen Ölwechsel und eine etwas genauere Service-Inspektion der Maschine. Anschließend fahren
Klaus und ich in der „golden hour“, dem warmen Licht der untergehenden Spätnachmittagssonne,
erneut in die Dünen, um kontrastreiche Fotos und Filmaufnahmen zu machen. Da alles erledigt ist, ist
abends mehr Zeit zum Quatschen und ein Bierchen.

Es ist herausragend an der Tuareg, dass man nicht gleich komplett aus der Wertung fliegt, sobald was
nicht klappt, sondern jeden Tag neu einsteigen kann. So bleibt Platz für neue Freundschaften,
besonders Kameradschaft ist groß geschrieben, die Selbstverständlichkeit, mit der man sich
gegenseitig hilft, ist eine der großen Bereicherungen dieses Events.
Zurück auf die Rennstrecke. In den Jahren zuvor mussten Amateure nur eine Runde im „King Stage“
fahren, was zu Beschwerden wegen zu geringer Herausforderung geführt hat. Generell wurde – nicht
zuletzt, um Fahrer der ausgewanderten Dakar aufzufangen – das fahrtechnische Niveau deutlich
erhöht. Das ist in Einzelfällen mehr als gelungen, wie aus den Ergebnislisten deutlich zu erkennen ist.
„Dune Race“ lautet die Überschrift auf der fünften Roadbookrolle - ein „kleiner“, vielleicht 15km Kurs
auf dafür um so höhere Dünen, auf denen natürlich Secret Check Points sind, muss mehrfach
gefahren werden. Ein beginnender Sandsturm erschwert die Sache. Nach der letzten Runde darf man
sein Glück am tief zerfahrenen Steilhang der Hausdüne versuchen, um Spott oder Ruhm der
Zuschauer zu ernten.
Das ist mir erspart geblieben, denn durch eine Unaufmerksamkeit und einen Defekt am
Roadbookhalter verpasse ich die erste Durchgangskontrolle, wodurch ich für heute disqualifiziert bin –
nur habe ich das nicht gewusst!
Durch den defekten Roadbookhalter arbeite ich verstärkt mit GPS, was mir heute zum Verhängnis
werden sollte. Ich verpasse Checkpoint 1, die Anzeige im Roadbook hat sich durch das Gerüttel
wieder einmal verstellt. Gleichzeitig hat das Satellitennavigationsgerät nach der Annäherung an CP1
automatisch auf CP2 den nächsten Checkpoint der aktiven Route geschaltet. Den hab ich dann
angesteuert, ohne nach CP1 Ausschau zu halten. Shit!
Ein Sandsturm kommt auf, die Sicht ist teilweise schlecht und das Fahren wird zur Strapaze. Die
Zwofuffziger muss auf den langen Steilauffahrten alles geben. Fehler bei der Spurwahl oder
zögerliches Schwungholen darf man sich nicht leisten. Navigationsfehler auch nicht. Ich schaffe zwei
der drei vorgeschriebenen Runden und werde erneut aus dem Rennen genommen, um auf der
Assistenzroute ins Lager zu fahren.
Es stört mich nicht, denn ich habe bis zum Schluss gekämpft wie ein Löwe. Leider völlig sinnlos, denn
laut Reglement ist man nach einer verpassten Durchgangskontrolle aus dem Rennen. Schlimmer
noch: Für jeden einzelnen nachfolgenden SCP und CP kassiert man eine Strafzeit als ob man ihn
nicht angefahren hat, d.h. es ist völlig egal, ob man dort war oder nicht! Insgesamt bekomme ich als
Feedback für meinen todesverachtenden Einsatz 23 (!) Strafstunden aufs Konto. Schlimmer hat es
Lothar und Stephan erwischt. Ihnen ist das gleiche passiert, nur in der Profiklasse haben sie für 4
Runden unfassbare 29 Strafstunden bekommen – als ob wir den Tag am Pool verbracht hätten.
Das Reglement wird seinen Grund haben, nur sehe ich erstmals Teilnehmer, denen die Freude
abhanden gekommen ist. Wohlgemerkt Teilnehmer, die in erster Linie zum Spaß und nicht um den
Sieg mitfahren. Beim Bier wird analysiert – wenn man in einem Tag 29 Strafstunden kassiert, muss
man schneller als das Licht gewesen sein, folglich in die Vergangenheit gereist sein und von dort Zeit
mitgebracht haben. Oder ist in den Dünen ein Wurmloch versteckt?

Der Sturm bringt Regen, über Nacht schüttet es mitten in der Wüste. Die groben Kamelhaardecken
unserer Nomadenzelte halten erstaunlich viel Wasser ab, dennoch brechen einige über Nacht ein.
Unser Freund Drago wird um vier Uhr früh unter dem schweren, klitschnassen, übelriechenden Stoff
begraben und musste sein Equipment unter widrigsten Umständen bergen. Die Wüste hat sich in ein
Schlammloch verwandelt. Einige Scouts erkunden morgens die Route und geben der Orga grünes
Licht für den Start. Nach einer schlüpfrigen Testfahrt ist klar, dass auch ich auf einen Start verzichte
und mich gemeinsam mit Klaus einer Gruppe direkt auf Asphalt Richtung Missor anschließe. Die Fahrt
ist eine Tortour. Die kleine WR bietet keinerlei Windschutz. Innerhalb kürzester Zeit sind wir völlig
durchnässt und müssen uns noch für Stunden ans Motorrad klammern. Am Horizont taucht
wolkenverhangen der hohe Atlas auf. Schneetreiben und Hagelschauer auf knapp 2000m entziehen
dem Körper die letzte Energiereserven.

Gebetsmühlenartig spreche ich mit klappernden Zähnen das Mantra „es geht vorbei“, versuche, die
Kälteschmerzen wertfrei wahrzunehmen. Nach 350 km war es vorbei. Heißer Tee, heiße Dusche,
heiße Neuigkeiten von kaltblütigen Fahrern. Der Slowene Niko ist als einer der wenigen Amateure ins
Rennen gegangen „Weißt Du Geheimnis von Fahren in Schlamm?“ streckt Arme nach vorne und
Hintern nach hinten „gaaanz hinten und seeehr schnell!“. Seine Laune ist prächtig, heute hat er seinen
Pass dabei gehabt und die Tageswertung gewonnen.
Von den Startern sind heute nur die schnellsten durchgekommen, der Wasserstand in den unzähligen
neu gebildeten Furten und Flüssen ist rapide gestiegen. Eine Gruppe konnte erst nach Stunden eine
Insel verlassen, nachdem der Wasserstand endlich gesunken war. Die meisten mussten abbrechen,
die letzte Etappe komplett gestrichen werden. Ein Auto wird im Fluss umgerissen, der Fahrer
eingeklemmt. Er konnte geborgen werden und liegt mit Unterkühlung im Krankenhaus. Erst spät
nachts waren alle Fahrer und Fahrzeuge geborgen.
Am letzten Tag in Afrika fahre ich Klaus hinterher. Ich hab keine Lust mehr mit defektem Roadbook
herumzuwurschteln und unsere Wertung ist uns längst egal. „Wir kämpfen ja doch nur um eine
goldene Ananas“, wie Bernd richtig bemerkt. Einziges Ziel ist Spaß zu haben und das Ziel ohne
Schaden an Mensch und Maschine zu erreichen. Nachmittags erreichen wir den Hafen Nador, um uns
über Nacht zurück nach Europa einzuschiffen. Eine kaum definierbare Stimmung macht sich breit, das
Bewusstsein, einen lang vorbereiteten Traum verwirklicht zu haben. Zufriedenheit wegen des Erfolgs
einerseits. Andererseits ist ein Traum dann weg, hat einen verlassen. Je länger und intensiver man darauf
hinarbeitet, desto größer die Leere, die er hinterlässt.

Der achte Renntag ist eine Kurvenorgie im südspanischen Bergland. Wer will, kann noch bis
Mittag richtig die Sau rauslassen. Dann sammeln wir uns zu einem Konvoi, einer kilometerlangen
Heldenparade, die durch das von Pensionistenhorden belagerte Mojacar donnert. Auf einem Parkplatz
am Strand steht das berühmte Podest. Jetzt gibt es Champagner für die Sieger, eine
Champagnerdusche für die Umstehenden und Bier für alle. Die Spannung lässt nach, es ist vollbracht,
an die 80% haben das Ziel erreicht und damit gewonnen.

Die echte „Winnerparty“ steigt abends im Irish Pub. Die ganze Bude ist für uns reserviert, Bier fließt in
Strömen, Ansprachen, Ehrungen, Applaus, letzte Chance zum E-Mail Adressen austauschen.
Die Erde bebt, Hopsing, ein alter Rallyehaudegen, hat seine offene 530er EXC angeworfen und führt
auf dem derben Offroad-Motorrad ein fast nacktes Mädchen ins Lokal. Im Blitzlichtgewitter steigt die
Kleine auf die Bühne, zieht ihre Show ab und die restliche Wäsche aus. Die Meute von zweihundert
Rallyepiloten, Wochen von ihren Frauen getrennt, tagelang damit beschäftigt, ihre Fahrzeuge durchs
Gelände zu prügeln, tobt vor Begeisterung. Hopsing verrät: „Ich wäre mit der Kleinen lieber aus dem
Lokal gefahren als hinein!“
Das Wetter lädt nicht ein, noch einen Urlaubstag anzuhängen. Also laden wir die Bikes auf den
Hänger und sind nach 30 Stunden wieder in Wien, wo gerade der Frühling Einzug hält.
Die 11. Tuareg ist Geschichte, ich komme wieder!
Wolfgang Niescher, Mai 2009